
Libertärer und poetischer Taoismus – Fengliu – Walking with the Wind
Aktie
„Es gibt einen Weg ohne Meister oder Dogma, ohne Ketten oder Unterwerfung. Eine wilde Spiritualität, die Pfaden folgt, die von keiner Religion markiert sind. Wo man dem Wind lauscht, zwischen Schönheit, Stille und Vergessenheit.“
Einführung in den Fengliu-Taoismus:
Fengliu (風流), wörtlich „mit dem Wind gehen“, ruft eine Art des Daseins in der Welt hervor, die zugleich elegant, frei und unbeugsam ist.
Es ist ein Taoismus, der sich nicht in Formeln, sondern in Gesten ausdrückt.
Ein libertärer Taoismus, der nicht in Tempeln rezitiert, sondern zwischen einem Becher Wein, einem im Morgengrauen geschriebenen Gedicht und einem Verschwinden im Berg gelebt wird.
Weder Doktrin noch Sekte noch festgelegte Praxis: Fengliu ist eine Ästhetik der Freiheit – eine Spiritualität ohne Vorschriften, bei der die Schönheit einfacher Dinge zum einzigen Ritual wird.
Seit mehr als zehn Jahren lebe ich zwischen den Straßen, den Mineralienmessen, den abgelegenen Gipfeln von Yunnan und den Gassen Asiens, umgeben vom Duft von Weihrauch und Regen.
Ich durchwandere diese Gebiete mit seltenen Gegenständen und einem Skizzenbuch in meiner Tasche, einem Kopf voller Mala- Kreationen, mit Licht gravierten Steinen und immer dieser Suche nach einem unsichtbaren Gleichgewicht – zwischen Präsenz, Schönheit und Rückzug.
Ich bin nie wirklich sesshaft, nie wirklich woanders, ich lebe nach dem Atem, in den Zwischenräumen der Welt und des Geistes.
So erkannte ich – ohne es benannt zu haben – an dem Tag, als ich es las, dieses Wort aus dem alten China: fengliu .
Dieser Blog ist eine Einladung, diese vergessene Weisheit wiederzuentdecken – eine Weisheit, der es egal ist, weise zu sein.
Durch die Figuren wandernder Dichter, betrunkener Mönche, einsamer Ästheten und paradoxer Meister lade ich Sie ein, mit mir auf den Spuren des Windes zu wandeln, an der Kreuzung von Tao , Buddhismus , Poesie und Entkleiden.

Er sagte, hier zu sterben bedeute, im Wind und Nebel wiedergeboren zu werden.
人生如夢,一尊還酹江月.」
„Das Leben ist ein Traum, ich gieße dem Mond auf dem Fluss eine letzte Tasse ein.“
Su Dong Po
— Persönliches Foto.
I – Ursprünge eines freien Geistes: Die Wurzeln von Fengliu
A. Das alte China: zwischen Zurückgezogenheit und Natürlichkeit.
Fengliu hat seine Wurzeln in uraltem Boden, bewässert vom Bergregen und der Stille der Einsiedler. Lange bevor es ein Wort war, war es ein Hauch – der des Tao, der sich einen Weg durch das Laub des Ziran (自然) bahnte, jenes „Natürlichen“, das man nicht erlernen kann, das sich aber offenbart, wenn man aufhört zu wollen.
Im archaischen China waren die ersten Weisen keine Religionsstifter, sondern Männer, die sich zurückzogen. Sie flohen vor Höfen, Verantwortungen und Ambitionen, um in der Spontaneität von Atem und Gesten zu leben. Der Zhenren (真人), der wahre Mensch, versucht nicht, die Welt zu korrigieren – er passt sich ihr an, so wie Wasser die Form von Felsen annimmt, ohne jemals zu brechen.
Im Mittelpunkt dieses Weges steht Ziran – das, was so von einem selbst kommt.
Ziran ist weder impulsiv noch sorglos, sondern eine Spontaneität ohne Willen. Es geht nicht darum, „zu tun, was man will“, sondern das entstehen zu lassen, was geboren werden will.
Im Daodejing heißt es, dass das Tao selbst „dem Ziran folgt“: Es ist daher die höchste Autorität – eine Autorität ohne Autorität.
Ziran zu sein bedeutet nicht, sich dem Strom zu widersetzen. Es bedeutet, ohne Masken, ohne Anmaßung, ohne Starrheit zu leben.
Der Wind rechtfertigt nicht, Wind zu sein. Wasser bemüht sich nicht, zu fließen.
Ebenso projiziert der Mensch im Einklang mit dem Tao nichts – er lässt zu, dass die Realität sich ihm einprägt wie eine Spiegelung auf der ruhigen Oberfläche eines Sees.
Aus dieser natürlichen Harmonie ergibt sich ein weiteres Grundprinzip des Taoismus: Wuwei (無為), das oft mit „Nicht-Handeln“ übersetzt wird, aber besser als „Handeln ohne Zwang“ verstanden werden sollte.
Wuwei ist keine Passivität und schon gar keine Trägheit. Es ist die Kunst, die Dinge ihrer Natur nach geschehen zu lassen, ohne einzugreifen oder sich aufzudrängen.
Der Mensch von Fengliu verweigert sich nicht der Aktion: Er handelt, wie der Wind ein Blatt bewegt, wie Wasser sich in Stein gräbt – ohne Lärm, ohne den Willen zur Kontrolle.
Er entscheidet nicht über den Weg: Er folgt der unsichtbaren Strömung des Augenblicks und passt sich der Realität an, anstatt sie seinen Wünschen zu unterwerfen.
Während der Konfuzianismus eine ständige Anstrengung verlangt, sich an die Norm anzupassen, tanzt Fengliu , getreu Wuwei , mit dem Moment.
Aus diesem Grund werden seine Handlungen oft als absurd oder rebellisch angesehen: Er trinkt, wenn die Leute von ihm erwarten, dass er meditiert, er geht weg, wenn die Leute wollen, dass er lehrt, er lacht, wenn alle weinen.
Doch darin ist er frei – und seine Freiheit hat keinen Namen. Sie hat nur die Form des Windes.
Fengliu ist der Erbe dieser Tradition des leuchtenden Rückzugs. Er ist Tao Yuanming, der Gelehrte, der den öffentlichen Dienst aufgab, um Chrysanthemen zu züchten und Gedichte am Rande des Sichtbaren zu schreiben.
Es ist Zhuangzi, lachend und unergründlich, der träumt, er sei ein Schmetterling, und sich dann fragt, ob er nicht der Traum eines Schmetterlings ist, der davon träumt, ein Mensch zu sein.
Es ist Liezi, die sich im wahrsten Sinne des Wortes vom Wind tragen lässt und für die Leichtigkeit keine Schwäche, sondern Weisheit ohne Gewicht ist.
Sie alle verkörpern diese aktive Ablehnung sozialer Belastungen, diese Entscheidung, in Harmonie mit der Welt zu leben, ohne sich jemals in ihr gefangen zu halten. Das Fengliu , das erst viel später so genannt wurde, ist bereits da, zwischen ihren Worten und ihrem Schweigen.

乘物以遊心.
„Sich auf die Dinge konzentrieren und frei umherwandern.“
( Zhuangzi, Kapitel 1 )
B. Gegenmodell des Konfuzianismus
Der Fengliu- Daoismus entstand im Hintergrund, als subtile, aber entschlossene Reaktion auf die vorherrschende moralische Ordnung des alten China: den Konfuzianismus mit seiner Abfolge von Pflichten, Hierarchien und Normen. Wo Konfuzius Rechtschaffenheit, Rang, Pietät und Unterwerfung unter Riten befürwortete, setzt sich Fengliu mit einer Geste anmutigen, fast ironischen Rückzugs dagegen ein: Es konfrontiert nicht mit Gewalt, sondern mit Schönheit, mit Losgelöstheit, mit der Eleganz, das Spiel nicht mitzuspielen.
Der Konfuzianismus ist eine vertikale Architektur: Jeder hat seinen Platz, seine Rolle, seine moralische Funktion. Er fordert den Menschen auf, sich nach festen gesellschaftlichen Formen zu formen und die Gegenwart der guten Ordnung des Ganzen zu opfern. Fengliu hingegen wählt das Umherschweifen statt des Status, Leichtigkeit statt der Pflicht, poetischen Rausch statt ritueller Ernsthaftigkeit.
Es handelt sich um eine fließende Gegenmoral, die freies Handeln gegenüber kodifizierter Tugend bevorzugt. Wo Konfuzius seinen Schüler auffordert, „ein guter Mensch“ zu werden, zieht der Fengliu -Schüler es vor, eine Wolke oder ein Grashalm im Wind zu sein. Er versucht nicht, das Gebäude eines vorbildlichen Lebens zu errichten: Er lässt das Leben vorbeiziehen wie einen Wein, den man unter dem Mond teilt.
Diese Haltung findet sich bei den Sieben Weisen des Bambuswaldes, emblematischen Figuren des 3. Jahrhunderts. Sie lehnen die Zwänge des kaiserlichen Protokolls ab und ziehen sich in die Natur zurück, um zu trinken, zu singen, Konventionen zu verspotten und ohne Ambitionen Verse für die Nachwelt zu verfassen. Ruan Ji beispielsweise feiert die Unvorhersehbarkeit des Lebens, den befreienden Rausch und die Hingabe an den Augenblick. Sie machen Wein zur Philosophie, Poesie zu einem Zufluchtsort und Wandern zur Kunst.
Fengliu ist keine politische Revolution – es ist eine bewusste und stilisierte Flucht. Eine lustvolle Auslöschung des sozialen Selbst, ein Weg, an den Rand der Welt zu rutschen und sich gleichzeitig zu weigern, ihr Garant zu sein. Fengliu bekämpft nicht die Macht; es macht sie durch seinen Tanz lächerlich.
So wird dieser Taoismus ohne Dogma auch zu einer sanften Rebellion gegen die obligatorische Tugend. Er zerbricht die starren Konturen des Junzi (君子), des konfuzianischen Adligen, um eine unruhigere, flexiblere Figur zu würdigen, die dem heiligen Verrückten oder dem vagabundierenden Dichter nahesteht.
Fengliu ist in diesem Sinne weniger ein System als vielmehr eine stilisierte Gehorsamsverweigerung: Es lacht, wenn die Moral Grimassen schneidet, es staunt, wenn die Weisen predigen. Es bietet eine nackte, zerbrechliche und großartige Freiheit, wie ein im Wind flatterndes Seidenkleid – ohne Nähte, ohne Gewicht, ohne Ziel.

„Ich gehe allein, ohne zu wissen, wohin. Das Universum ist riesig, warum sollte ich mich in Mauern einschließen?“
— Ruan Ji (阮籍)
C. Zwischen Atem und Leere: Taoistisch-buddhistischer Synkretismus von Fengliu.
Wenn Fengliu aus der taoistischen Matrix geboren ist und sich am Rande des Konfuzianismus behauptet, wird es aus der Tang- und Song-Dynastie durch eine andere Quelle bereichert: den Chan-Buddhismus, diese chinesische Kunst der unmittelbaren Leere, des Erwachens ohne Konzept und des bodenlosen Lachens.
Chan – der Vorläufer des Zen – schlägt eine Meditation ohne Objekt, ohne Erwartung, ohne Versprechen vor. Es geht nicht darum, aufzusteigen, sondern sanft in den Moment zu versinken, bis nur noch die nackte Geste übrig bleibt, das Wort, das wie ein Tropfen auf einen Stein fällt. Diese Art des Stillstehens ist tief mit dem taoistischen Ideal des Wuwei verbunden, fügt ihm aber die radikale Leere des Buddhismus hinzu: Es gibt nichts zu tun, niemanden zu retten, nicht einmal ein Selbst zu befreien.
Fengliu begrüßt diesen Hauch Indiens ganz selbstverständlich. Er sucht nicht zwischen Lehren zu entscheiden – er schwebt zwischen den Ufern und lässt sich vom Humor der Vergänglichkeit durchdringen. Die Figuren ändern sich, doch der Wind bleibt derselbe.
So lachen Hanshan und Shi De, die verrückten Dichter des kalten Berges, wie Kinder im Nebel von Tiantai. Sie kritzeln Verse auf Felsen, stehlen Brötchen aus Klöstern, sprechen in Rätseln und verschwinden, wie sie gekommen sind.
Später war es der sechste Dalai Lama, Tsangyang Gyatso, der diese unruhige Freiheit verkörperte: Mönch, Liebhaber, nächtlicher Dichter, Schatten- und Weintrinker, schrieb er:
„Da ich weder Himmel noch Erde gefunden habe, um mein Leben niederzulegen,
Ich legte mich in den Wind.
Auf diesen Wegen wird das Wandern zur Befreiung. Der taoistische Einsiedler wird manchmal zum Zen-Bettler, zum urkomischen Propheten, zu einer geisterhaften Präsenz. Er definiert sich nicht mehr: Er geht, er lauscht, er vergisst. Das Gedicht wird zum Gong An (später Koan in Japan), einem Rätsel ohne Lösung, einer Windspur im Staub.
Der Kelch Wein ist kein irdisches Vergnügen mehr und auch kein gesellschaftlicher Verstoß: Er wird zu einem Opfer ohne Altar, zu einer Trunkenheit ohne Thema.
Dieser Synkretismus ist niemals doktrinär – er ist lebendig, durchlässig, fließend. Fengliu wird dann zu einer Spiritualität ohne Namen:
weder rein taoistisch noch rein buddhistisch, sondern zwischen zwei Atemzügen schwebend,
berauscht von der Schönheit der Welt und bewohnt von der Leere des Herzens.
Er sucht nicht mehr nach der Wahrheit – er geht schweigend und mit offenen Armen hindurch,
wie eine Wolke, die zwischen zwei Kiefern hindurchzieht, ohne eine Spur zu hinterlassen, aber alles verwandelt zurücklässt.

山中何所有?
嶺上多白雲.
只可自怡悅,
不堪持贈君
Was können wir in den Bergen finden?
Weiße Wolken über den Bergrücken.
Sie dienen nur meiner eigenen Freude,
Ich kann sie niemandem geben.
- Gedicht von Hanshan (寒山詩 Nr. 44)
So wird der Geist von Fengliu umrissen: geboren aus der Stille, genährt vom Umherwandern, frei zwischen den Atemzügen. Doch wer sind diejenigen, die ihn so sehr verkörperten, dass sie zum Wind selbst wurden?
II – Leben als Dichter: emblematische Figuren von Fengliu
A. Chinesische Dichter
Li Bai: himmlischer Rausch, heilige Lässigkeit.
Wang Wei, Bai Juyi, Du Fu: Rückzug, Beschwerde, Natur.
Fengliu ist keine Theorie. Es ist eine Art, die Welt zu bewohnen – mit Rausch, mit Entzug, manchmal mit Schmerz, aber immer mit Stil. Seine natürlichste Form findet es in der Poesie, als wären freie Verse, der zitternde Pinsel auf dem Papier, die einzig möglichen Antworten auf das Rätsel der Existenz.
Unter denen, die diesem Weg seinen unsterblichen Atem verliehen, steht Li Bai (李白) wie ein Komet. Er schrieb nicht: Er tanzte mit Tinte. Er lebte nicht: Er loderte im Augenblick.
Seine Trunkenheit war keine Schwäche, sondern der Zugang zum Himmel.
Er rief die Götter zum Trinken, lachte über die Kaiser, goss seinen Wein in den Fluss und sagte dem Mond, er solle ihm folgen.
Seine Kunst erinnerte an taoistische Magie: Indem er sich durch den Kelch und das Gedicht erhob, hob er die Grenze zwischen dem Menschen und den Sternen auf.
„Im Schlaf verliere ich das Universum;
indem ich mich betrinke, finde ich ihn wieder.“
– Li Bai
In Wang Wei (王維) erhält Fengliu ein anderes Gesicht: das der Stille, der Landschaft und des Pflanzenfriedens. Als buddhistischer Mönch und Maler der Leere schrieb er wie ein Meditationskünstler, in einem Rückzug, der nicht Flucht, sondern Verschmelzung ist. Seine Gedichte sind Einsiedeleien aus Papier:
wir hören den Wind in den Kiefern,
wir sehen den Schatten der Berge auf einer Schale Tee.
Du Fu (杜甫) hingegen ist ernster, stärker in der Welt verwurzelt. Er singt von Ruinen, Hungersnöten, Kriegen, aber immer mit jener inneren Genauigkeit, die Klagen in Opfergaben, Schmerz in Klarheit verwandelt. Selbst im Elend bewahrt er sich eine Form gebrochener Eleganz – ein melancholisches Fengliu.
Bai Juyi (白居易) seinerseits war der Dichter der goldenen Mitte:
Er war zurückgezogen, ohne die Welt zu verleugnen, und empfand Ungerechtigkeit genauso sensibel wie die Schönheit eines Schwans auf einem Teich. Er hatte eine bittersüße Lebenseinstellung, die von diskretem Humor und Zärtlichkeit für die Menschen geprägt war.
Diese Dichter haben nie eine Abhandlung über Fengliu geschrieben, aber sie haben seine unsichtbaren Konturen skizziert.
Sie lehren uns, dass das Leben als Dichter nicht nur aus dem Schreiben besteht:
Es bedeutet, mit einer leeren Tasse, einem tiefen Atemzug und einem Blick durch die Welt zu gehen, der den Frühling selbst im Nebel erkennen kann.

偷採白蓮回.
不解藏蹤跡,
浮萍一道開.
Ein Kind schiebt ein leichtes Boot,
Er pflückt heimlich weiße Lotusblumen.
Da er nicht weiß, wie er seine Spur verwischen soll,
Es hinterlässt einen offenen Pfad in der Wasserlinse.
Bai Juyi
Im Gegensatz zu den asketischen Stereotypen, die den tibetischen Weisen zugeschrieben werden, verkörpert Tsangyang Gyatso (1683–1706), der sechste Dalai Lama, eine paradoxe und untypische Figur: Mönch und Dichter, spiritueller Führer und sinnlicher Flüchtling, ist er der Verfechter von Fengliu in seiner subversivsten und verkörpertesten Version.
In seiner Kindheit zum Dalai Lama ernannt, lehnte er schon früh die Zwänge des Klosters ab. Er zog die Nächte Lhasas den rituellen Tagen vor, Liebeslieder den obligatorischen Gebeten. Wir sehen ihn betrunken und als Laie gekleidet im Mondschein umherwandern und Gedichte von ergreifender Einfachheit verfassen. In seinem Mund verläuft die Suche nach Erwachen durch Verlangen, Verlust und die Vergänglichkeit des Augenblicks.
„Wie können wir die beiden Wege in dieser Welt miteinander vereinbaren?
„Verrate weder den Buddha noch den Geliebten?“
Allein dieser Satz fasst sein ganzes Schicksal zusammen: hin- und hergerissen zwischen der Leere des Buddha und der Wärme des Körpers, zwischen dem Ruf des Dharma und dem des Fleisches. Er entschied sich nicht für das eine oder das andere – er wandelte zwischen beiden, berauscht von Schönheit und Widerspruch.
In der tibetischen Tradition gilt er als Mysterium, ja sogar als Skandal. Doch im Licht von Fengliu wird er zu einem Meister aus eigenem Recht: Er lehrt durch sanfte Überschreitung, durch die Verschmelzung des Heiligen und des Profanen, indem er nicht über der Welt erwacht, sondern in der Brillanz dessen, was er zugleich anbietet und wegnimmt.
Von den Behörden ins Exil geschickt, verschwand er unter ungeklärten Umständen und hinterließ eine Handvoll Gedichte und eine Legende: die eines Dalai Lama, der keinen Thron wollte, sondern einen Kelch, den er mit dem Wind teilte.
„Wer war ich, bevor ich geboren wurde?
Wer bin ich geworden, als ich geboren wurde?
In dieser nackten Befragung, getragen von der Stimme eines Mannes, der alles außer seinem Atem verloren hat, erreicht der Fengliu den Abgrund – und tanzt dort.

C. Japan – der wütende Geist
Saigyō: Der wandernde Mönch.
Bashō: Erwachen im Haiku.
Ryōkan: Liebe, Einfachheit, Kinderspiel.
In Japan ändert Fengliu zwar seinen Namen, aber nicht sein Aussehen. Es heißt Fûryû (風流): der „Fluss des Windes“, die Verfeinerung, die die Natur umarmt, die flüchtige Eleganz der Einsamkeit, des Reisens, der plötzlichen Blüte. Auch hier ist nichts Doktrinäres: Es ist eine Haltung, ein Atemzug, eine Art, in der Schönheit zu verschwinden, ohne sie erfassen zu wollen.
🌸 Saigyō (西行) – Der wandernde Mönch
Saigyō, ein ehemaliger kaiserlicher Wächter, der im 12. Jahrhundert zum wandernden buddhistischen Mönch wurde, verkörpert diese Mischung aus Zurückgezogenheit und Sensibilität. Er verlässt Kyoto, um allein unter den Kirschbäumen spazieren zu gehen, dem Mond zu schreiben und im Regen zu schlafen.
Sein Buddhismus ist nicht von trockener Entsagung geprägt, sondern von einem von Blumen und Jahreszeiten geprägten Loslassen, immer am Rande von Tränen und Ekstase.
Sogar unter den Kirschblüten,
Mich ergreift eine Trauer, die ich nicht benennen kann.
— Saigyō
🐚 Bashō (芭蕉) – Erwachen im Haiku
Bei Matsuo Bashō wird Poesie zu einer minimalen Pilgerreise. Sein Haiku ist kein Ornament, sondern eine Geste des Erwachens. Er wandert Tausende von Kilometern durch Japan, schläft bei Fischern, betrachtet einen Felsen, lauscht einem Frosch.
Das Haiku fängt in drei Atemzügen die Ewigkeit eines Augenblicks ein:
Ein alter Teich —
ein Frosch taucht ...
Geräusch von Wasser.
— Bashō
Alles ist da: das Nichts, alles, der Übergang, die Stille. Bashō, ein Mönch ohne Dogma, Freund des Grases und des Windes, macht die Welt zu einer lebendigen Seite.
🎒 Ryōkan (良寛) – Liebe, Einfachheit, Kinderspiel
Der letzte dieser unsichtbaren Linie, Ryōkan, ein Zen-Mönch aus dem 19. Jahrhundert, ist wohl der zärtlichste. Er lebt in einer Hütte, teilt seinen Reis mit Insekten, spielt Verstecken mit Kindern, schreibt Gedichte für seine geliebte Nonne Teishin und weint manchmal ohne Grund.
Sein Erwachen ist menschlich, zerbrechlich, leuchtend. Er predigt nichts. Er gibt, ohne zu zählen. Er lässt sich vom Leben entblößen, mit einem Lächeln, das ein wenig traurig, ein wenig verrückt ist.
Wer die Intimität des Windes kennt
braucht keinen Tempel mehr.
— Ryōkan
In ihnen wird Fengliu zu Kirschnebel, Kinderlachen, unvollendeter Kalligraphie.
Sie flohen nicht aus der Welt, sondern bewohnten sie wie ein Haus, das dem Wind ausgesetzt war.
wo nichts irgendjemandem gehört und wo man sich vor einem Insekt wie vor einem Gott verneigt.

旅に病んで
夢は枯野を
かけ廻る
Krank auf Reisen,
mein Traum läuft immer noch
über die ausgedörrte Ebene.
Bashō,
III – Eine verkörperte Philosophie: die Prinzipien von Fengliu
A. Eine Spiritualität ohne Dogma
Fengliu etabliert keine Schule, kein Dogma, kein Ritual. Es folgt keiner Orthodoxie, identifiziert sich nicht mit einer Institution. Es ist Atmung, keine Vorschrift. Wo Religionen Tempel bauen, sitzt Fengliu unter einem Baum, im Staub des Weges, und sieht den Blumen beim Fallen zu.
Es ist keine gewaltsame Revolte, sondern eine sanfte Ablehnung. Vor allem eine Ablehnung des Moralismus – dieses Wunsches zu urteilen, zu korrigieren, Handlungen und Gedanken einer Idee des Guten anzupassen. Fengliu strebt nicht danach, „gut“ zu sein, geschweige denn, eine Tugend aufzuzwingen. Er zieht die Unschuld der richtigen Geste der Last tugendhafter Verpflichtungen vor. Er weiß, dass Moral ohne Poesie schnell zur Tyrannei wird.
Es ist auch eine Ablehnung des Ritualismus. Nicht, dass der Fengliu Riten verachtet: Manchmal erkennt er ihre Schönheit. Aber er weiß, dass ihre leere Wiederholung den Atem austrocknen kann. Es kommt nicht darauf an, die perfekte Formel zu rezitieren, sondern den Moment genau zu erleben und zuzuhören. Das Heilige wird nicht künstlich hergestellt – es entsteht zwischen einer Tasse dampfenden Tees und dem Lachen eines Kindes, im Rascheln eines vom Wind gelüfteten Vorhangs.
Hier wird Wuwei (無為) zum unsichtbaren Zentrum dieser Spiritualität: Nichthandeln, oder besser gesagt, Handeln ohne Zwang. Niemals etwas erzwingen. Nicht an einer Blume ziehen, um sie zum Wachsen zu bringen. Nicht gegen die Welt kämpfen, sondern zwischen ihren Atemzügen gleiten. Das Wuwei von Fengliu ist keine Trägheit – es ist die Kunst der Anpassung. Es ist wie eine Mahlzeit zubereiten, ohne Lob zu erwarten. Es ist wie ein Gedicht schreiben, ohne Unsterblichkeit zu wollen. Es ist zu wissen, wie man verschwindet, wenn alle anderen angeben.
Doch was Fengliu mit den tiefgründigen östlichen Weisheiten – Chan, Dzogchen, Zen – gemeinsam hat, ist die Leere, die nicht als Idee, sondern als poetische Erfahrung erfahren wird.
Die Leere muss nicht gefürchtet werden. Sie ist der Raum, in dem die Welt erblüht.
Beim Fengliu versucht man nicht, sich selbst zu „verwirklichen“, man lässt sich auflösen. Wie ein Fußabdruck im Schnee, wie eine Flamme im Wind.
Kein Erwachen zu erreichen, kein Nirvana zu erobern. Nur Momente.
Eine angeschlagene Schüssel, die wir mit Zärtlichkeit betrachten.
Ein abgefallenes Blatt, das wir nicht aufzuheben wagen.
Die Stille zwischen zwei Versen, die mehr sagt als Worte.
So wird diese Spiritualität ohne Dogma zu einem stillen Tanz zwischen Atem und Leere.
Sie verspricht nichts – sie bietet alles an und hält nichts zurück.
Und derjenige, der ihm folgt, hat weder Namen, noch Funktion, noch Botschaft:
es weht Wind in den Zweigen,
Schatten auf dem Stein,
Lichtpräsenz, die Licht durchlässt.

茶の湯とは
ただ湯を沸かし
茶を点てて
飲むばかりなる
Der Weg des Tees,
es ist nur das Erhitzen von Wasser,
Tee zubereiten,
und trink es.
— Sen no Rikyū (千利休), Teemeister aus dem 16. Jahrhundert
B. Eine Ästhetik des Alltags
Wohnen mit Genuss: Die Kunst des Dekorierens, Essens, Liebens.
Shen Fu und Li Yu als Meister einer raffinierten Lebenskunst.
Fengliu lebt nicht in Askese, sondern in der diskreten Eleganz alltäglicher Gesten. Er lehnt die Welt nicht ab: Er streichelt sie. Wo andere das Absolute in Transzendenz oder Flucht suchen, findet der Fengliu-Mann Erleuchtung in einer Schüssel warmen Reis, einem Zweig eines blühenden Pflaumenbaums oder einem zum Frühling passenden Kleidungsstück.
Es handelt sich um eine verkörperte Spiritualität, die sich in der Kunst ausdrückt, sein Zimmer wie ein stilles Gedicht zu dekorieren, die Leere um eine Vase herum zu ordnen oder eine Parfümlinie in die Laken zu ziehen.
Essen wird zu einem kontemplativen Akt, der einen Dialog ohne Worte hervorruft. Es geht nicht darum, das eigene Leben zu verschönern, sondern eine stille Poesie einzuschreiben – eine Aufmerksamkeit.
Diese alltägliche Köstlichkeit ist nicht kostbar: Sie wird angeboten. Sie entsteht aus dem Blick, dem Atem, der Sorgfalt, die dem gegenwärtigen Augenblick gewidmet wird. Jedes Objekt wird mit Bedacht ausgewählt, jede Stille zeugt von Ehrfurcht. Fengliu verwandelt die kleinste Sache in ein unzeremonielles Ritual – eine Kerze, die in der Dämmerung entzündet wird, eine Kalligrafie, die im Wind schwebt, eine Tasse, die wie ein zerbrechliches Herz in beiden Händen gehalten wird.
Shen Fu (沈復) gibt in seinen „Sechs Geschichten eines fließenden Lebens“ einen bewegenden Bericht darüber. Er erzählt von seiner Liebe zu seiner Frau Yun, der Anlage eines kleinen Gartens, ihren gemeinsamen Lesungen unter der Lampe, ihrer von Harmonie erfüllten Armut. Es ist keine Abhandlung, sondern ein Angebot: das einer Lebenskunst, in der Intimität zum Tempel und Teilen zu Musik wird.
Li Yu (李煜), der letzte König der Südlichen Tang-Dynastie, verkörpert extreme Kultiviertheit gepaart mit Schmerz. Als Dichter und Ästhet lebte er im sterblichen Luxus eines zum Verschwinden verurteilten Hofes und verfasste dort Verse von ergreifender Zärtlichkeit, voller Seide, Mondlicht, Tränen und Düften.
Selbst in der Gefangenschaft hörte er nie auf, seine Tage zu verschönern: Er schrieb, wie man sterbenden Weihrauch einatmet. Für ihn wird Eleganz zum Widerstand – nicht gegen die Welt, sondern um ihr ein letztes Lied anzubieten.
Diese Figuren erinnern uns daran, dass es beim Leben mit Schönheit nicht um Besitz, sondern um die Wahl geht.
Es geht nicht um Anhäufung, sondern um Reinigung.
Es geht nicht darum, sich von der Welt zurückzuziehen, sondern ihr Gesten anzubieten, die nichts verletzen.
In der Ästhetik von Fengliu wird das Alltägliche zu einem stillen Opfer.
Es geht nicht mehr darum, „sein Leben erfolgreich zu gestalten“, sondern darum, es auch im Vergänglichen lebenswert zu machen.
Malen Sie den Moment mit den Farben des Herzens.
Und wenn alles vorüber ist, bleibt nichts zurück – außer der süßen Schönheit, die in der Erinnerung des Windes bleibt.
Im Fengliu sind die Künste keine vom Leben getrennte Tätigkeit: Sie sind Leben, verklärt durch die Eleganz der Gesten, die Langsamkeit des Blicks, die Unentgeltlichkeit der Schönheit. Poesie, Malerei, Kalligrafie, Musik, Teekunst, Gartenarbeit oder Kochkunst – sie alle werden zur stillen Sprache des Lebensatems, einer Erweiterung des Tao ins Vergängliche. Einen Bambus bemalen, ein Haiku schreiben, eine Tasse Tee einschenken oder auf der Guqin improvisieren: Diese Handlungen haben kein anderes Ziel, als das Sein mit der Welt in Einklang zu bringen, mit Leichtigkeit und Präzision. Diese Lebenskunst braucht keine Tempel oder starren Zeremonien: Eine angeschlagene Schale, ein gefallenes Blatt, eine in der Leere schwebende Note genügen. Weder technisches Können noch Meisterschaft zählen, sondern Stil – dieser subtile Rhythmus des Atems , den die Alten Qi Yun (氣韻) nannten. Durch die Künste lehrt uns Fengliu, die Welt mit Zärtlichkeit zu bewohnen, die Stille wie eine Melodie zu feiern, alles so sein zu lassen, wie es ist, in der fließenden Schönheit eines Augenblicks, der nicht wiederkehren wird.

Die Musik, die dem Tao folgt, füllt den Raum nicht – sie lauscht ihm.
Jede Note wird wie ein Tropfen in der Leere geboren,
nicht um zu verführen, sondern um anmutig in Stille zu verschwinden.
C. Der Windmann
Zhenren Ziran : Frei, marginal, ironisch, elegant
Er versucht nicht, anders zu sein. Er ist einfach so, weil er sich nicht zwingt, wie alle anderen zu sein.
Der Mensch von Fengliu ist ein Zhenren Ziran (真人自然): ein wahres Wesen, spontan im Einklang mit der Welt. Er beansprucht nichts. Er durchlebt die Tage wie der Wind durch die Kiefern – ohne eine Spur zu hinterlassen, sondern überall eine Schwingung zu erwecken.
Man nennt ihn marginal, aber er läuft vor nichts davon. Er wählt die Zwischenräume, die unbetretenen Pfade, die Stille zwischen zwei Sätzen. Er lebt an den Schwellen: zwischen Natur und Gesellschaft, Einsamkeit und Zärtlichkeit, Poesie und Rückzug. Er ist kein lautstarker Rebell, sondern ein diskreter Rebell – seine Waffe ist der Stil, seine Stärke ist die Losgelöstheit.
Seine Ironie ist sanft: Er lacht über Anmaßungen, nicht über Menschen.
Seine Freiheit ist keine Haltung, sondern eine tiefe Entspannung – wie eine zu gespannte Saite, die endlich im Takt schwingen darf.
Er ist derjenige, der langsam im Regen geht, derjenige, der dem Wind einen Vers vorträgt, derjenige, der lautlos von einem Bankett verschwindet.
Er versteht es zu lieben, ohne zu besitzen, zu schaffen, ohne zu unterschreiben, zu erscheinen, ohne zu dominieren. Seine Größe ist umso realer, weil sie weder nach Blicken noch nach Anerkennung sucht.
Der Mann des Windes lebt ohne Zwänge oder Dogmen. Er bewohnt die Welt, ohne an ihr zu hängen.
Seine Eleganz wirkt nie aufgesetzt – sie kommt aus freiem Herzen.
Er kleidet sich dem Wetter entsprechend, liest Bücher, während man atmet, und spricht wenig, weil er weiß, dass Reden das erschöpft, was Schweigen befruchtet.
Dieser Zhenren , dieses wahre Wesen, hat keine Ideologie, keine Rüstung. Er ist einfach wie Wasser, das sich jeder Vase anpasst.
Doch hinter dieser Einfachheit verbirgt sich eine seltene Radikalität: die, sich nichts aufzwingen zu wollen, nicht einmal sich selbst.
Manchmal sieht er aus wie ein verrückter Dichter, ein verträumter Einsiedler, ein eleganter Bettler. Wir erkennen ihn nicht immer, aber wir spüren seine Anwesenheit – wie ein vergessenes Parfüm in einem leeren Raum oder wie die Spur eines Flügels in der frischen Morgenluft.

《道德經》第二十三章
希言自然.
故飄風不終朝,驟雨不終日.
。
天地尚不能久,而況於人乎?
故從事於道者,同於道;
德者,同於德;
失於失.
Wer nicht spricht, (kommt zum) Nichthandeln.
Ein frischer Wind hält nicht den ganzen Morgen an und ein starker Regen hält nicht den ganzen Tag an.
Wer bringt diese beiden Dinge hervor? Himmel und Erde.
Wenn Himmel und Erde nicht lange Bestand haben, wie viel mehr kann es der Mensch!
Wenn sich der Mensch also dem Tao hingibt, identifiziert er sich mit dem Tao.
wenn er sich der Tugend hingibt, identifiziert er sich mit der Tugend;
wenn er ein Verbrechen begeht, identifiziert er sich mit dem Verbrechen.
Dao De Jing Kapitel 23
IV – Rausch, Sinnlichkeit und Erwachen
A. Wein als Weg
Auflösung des Selbst im Rausch. Poesie, Ekstase, Entblößung.
In Fengliu ist Wein kein Ausweg, sondern ein Übergang.
Es ist weder Sucht noch Laster noch bloße Unterhaltung: Es ist ein Weg zum Erwachen.
Ein Wein wird langsam eingeschenkt, ein Becher wird zum Mond erhoben, ein Moment des Flackerns – und schon lösen sich die Grenzen zwischen dem Selbst und der Welt auf.
Der Fengliu-Rausch ist nie ausgelassen. Er ist ein innerer Nebel, ein sanfter Verlust der geistigen Starrheit, ein freudiges Abstreifen der sozialen Maske.
Es ist die Aufgabe des „Ich“ zugunsten des Atems.
Trinken heißt hier, verlernen. Es heißt, nicht mehr verstehen zu wollen. Es heißt, sich von der Realität berauschen zu lassen.
Li Bai, der himmlischste aller chinesischen Dichter, machte es zu seinem Weg.
Er trank, um den verlorenen Stern des Tao zu finden und seinen Namen in den Wolken zu verlieren.
Er schrieb betrunken, schwebte zwischen Bergen und Palästen und warf seine Gedichte, wie man sein Lachen zum Himmel wirft.
「對影成三人」
Ich trinke allein, mein Schatten und der Mond leisten mir Gesellschaft.
In diesem heiligen Rausch hört der Geist auf zu rechnen. Er setzt sich schutzlos dem Schwindel der Welt aus.
Poesie wird zu Atem. Atem wird zu Wind. Wind wird zu Stille.
Wein braucht kein Festmahl. Alles, was er braucht, ist ein Stein, ein Kelch, ein Vogel.
Es versucht nicht, das Bewusstsein auszulöschen, sondern es aus sich selbst herauszuheben.
Der Trinkende wird zum Wind zwischen den Kiefern, zur Spiegelung im Wasser, zum reinen Augenblick.
Dort beginnt das Strippen: nicht in trockenem Verzicht, sondern in einer nackten, leichten Ekstase, in der alles Gewichtige transparent wird.
Doch nicht nur Wein ermöglicht ein anmutiges Selbstvergessen.
In manchen dunklen Bergen, wo die Stille die Farbe von Jade hat, sprechen die Menschen noch immer von Nebelpilzen, von Kräutern der Unsterblichkeit. Nicht um zu heilen – sondern um aufzulösen.
Sie vermitteln keine Visionen – sie löschen sie aus.
Sie öffnen keine Türen – sie lassen sie schweben.
Wer sie einnimmt, wird nicht hellsichtig.
Es wird Wind.
Ein Blick ohne Konturen, ein Hauch, der die Kiefern streichelt.
„Ich weiß nicht mehr, wer ich bin,
aber die Steine erkennen mich.“
— Anonymes Echo eines vermissten Einsiedlers
Es geht nicht darum, Ekstase zu suchen, sondern sich sanft vergessen zu lassen.
Manchmal sind es nicht die Substanzen, die den Geist verändern,
sondern der Geist, der bereit ist, die Materie mit sich auflösen zu lassen.
Es sei darauf hingewiesen, dass bestimmte esoterische taoistische Strömungen, insbesondere in der inneren Alchemie und der alten spirituellen Medizin, Pflanzen namens Lingzhi (靈芝) – sogenannte „spirituelle“ oder „unsterbliche“ Pilze – beschwören. Diese Pilze werden mit Langlebigkeit, der Transformation des Wesens und sogar der leuchtenden Trance des Körpers in Verbindung gebracht.
Diese Symbole können als poetische Brücke dienen: Nicht die Veränderung der Wahrnehmung ist entscheidend, sondern die Veränderung des Blicks.

《月下獨酌》其二
„Allein trinken unter dem Mond“ – II
花間一壺酒,
獨酌無相親.
舉杯邀明月,
對影成三人.
月既不解飲,
影徒隨我身.
暫伴月將影,
行樂須及春.
我歌月徘徊,
我舞影零亂.
醒時同交歡,
醉後各分散.
永結無情遊,
相期邈雲漢.
Ein Krug Wein zwischen den Blumen,
Ich trinke allein, ohne Begleitung.
Ich erhebe meine Tasse, ich lade den Mond ein,
Und mein Schatten, hier sind wir drei.
Der Mond kann nicht trinken,
Der Schatten folgt mir, ohne etwas zu sagen.
Aber für einen Moment nehme ich sie als Gefährten:
Genießen wir den Frühling, bevor er vorbei ist.
Ich singe, der Mond wandert.
Ich tanze, mein Schatten löst sich auf.
Lucid, wir teilen die Freude;
Betrunken geht jeder seiner Wege.
Doch möge diese Reise ohne Bindung ewig dauern,
Gehen Sie über die Wolken hinaus zur Milchstraße.
Li Bai
B. Sexualität und Tao
Fangzhongshu: Vereinigung als Alchemie.
Raffinierte Erotik: zwischen Lust und Leere.
Im Fengliu ist Sexualität weder tabu noch sakralisiert. Sie ist ein Weg – ein Atemzug – eine subtile Kunst, den Körper zu bewohnen, ohne in ihm gefangen zu sein. Wo moralische Dogmen das Verlangen auf Scham oder Selbstbeherrschung beschränken, heißt Fengliu es willkommen wie eine Brise unter anderen: mal stark, mal sanft, immer flüchtig, immer kostbar.
Fangzhongshu (房中術) – wörtlich: die Kunst des Schlafzimmers – ist eine der ältesten Traditionen des körperlichen Taoismus. Diese Kunst, die seit der Antike in bestimmten Schulen praktiziert wird, zielt weder auf pure Erregung noch auf heroisches Zurückhalten, sondern auf die Zirkulation des Lebensatems zwischen den Körpern. Lust wird zur Alchemie, nicht durch Kompliziertheit, sondern durch Aufmerksamkeit.
Der Akt der Liebe ist weder Dominanz noch Verlassenheit: Es ist Anpassung.
Wie beim Wuwei geht es nicht um Zwang, sondern um Einfügen.
Körper ergreifen einander nicht – sie stimmen überein.
Man sagt, dass in diesen Momenten das Qi frei zirkuliert, Licht zwischen Nieren und Herz erwacht und die beiden Atemzüge eins werden. Doch Fengliu versucht nicht, diese Erfahrungen in Diagrammen oder Rezepten festzuhalten: Es bevorzugt Suggestion gegenüber Vorschrift, Zärtlichkeit gegenüber Kontrolle.
Die Sexualität von Fengliu ist erotisch, aber niemals vulgär.
Sie liebt Seufzer, Schweigen, Blicke.
Sie zieht den Duft eines Halses der Eroberung eines Körpers vor.
Dies ist keine verkappte Askese. Es ist ein leichtes, manchmal tiefgründiges Spiel, bei dem die Freude weder gepriesen noch abgelehnt, sondern als Erfahrung der Leere erlebt wird: Sie steigt auf, sie blüht, sie vergeht. Sie hinterlässt nichts außer einer warmen Spur in der Luft und einem Lächeln im Schatten.
Wie Wein kann körperliche Liebe Türen öffnen – aber nur, wenn Sie nicht versuchen, sie zu erzwingen.
In alten Gedichten wird das Verlangen oft mit leiser Stimme geflüstert:
ein Kleid, das auf eine Tatami-Matte geschlüpft ist,
eine zitternde Haarlocke,
eine Hüfte, die unter einer Öllampe gebürstet wurde.
Hier erreicht Fengliu seine ultimative Verfeinerung:
wenn Freude zur Poesie wird,
und dieser Genuss verschwindet in einem Haiku.
Doch nicht nur die taoistische Weisheit erkannte die Macht der Vereinigung als Weg.
In den Höhen Tibets oder den Höhlen des alten Indiens öffnete sich eine andere Tradition, das Tantra, der gleichen Wahrheit: dass das Erwachen nicht der Feind des Körpers ist, sondern sein Geheimnis.
Im tantrischen Buddhismus wird die sexuelle Vereinigung – manchmal symbolisch, manchmal real – zu einem Ritual des Erwachens.
Nicht um das Vergnügen zu verlängern, sondern um die Dualität aufzulösen.
Der Liebhaber und die Geliebte sind nicht länger zwei.
Sie werden zu einer Vereinigung von Leere und Form,
der Bewegung und Stille,
Feuer und Raum.
In dieser Vision soll Sex nicht gemieden, sondern verklärt werden.
Dies ist nicht jedermanns Weg – er erfordert die Beherrschung von Energie, ausgeprägte Klarheit und eine Klarheit des Geistes, bei der Verlangen nicht mehr zu Mangel, sondern zu Transparenz führt.
Vergnügen ist kein Ziel mehr, sondern ein Mittel der Offenbarung.
Es erhellt die Knoten des Selbst, es löst Fixierungen auf, es enthüllt die Schönheit der Welt als reinen Impuls.
Aus diesem Grund vereint der Buddha im tibetischen Yab-Yum seinen Frieden mit der Glut einer Göttin – nicht um Freude daran zu haben, sondern um die Welt als Opfergabe wieder zu integrieren.
Obwohl die tantrische Tradition und die des Fangzhongshu aus unterschiedlichen Kontexten stammen, haben sie doch die gleiche Vorahnung:
Wenn man sich der Vereinigung bewusst ist, kann sie zu einem Weg werden.
Nicht den Körper zu überwinden, sondern ihn ohne Angst zu bewohnen –
Damit die Umarmung zum Opfer wird,
Und der Orgasmus, Stille.

„Wenn Sie sich dessen bewusst sind, werden Sie erkennen, dass Sexualität nicht nur Sex ist.
Sex ist die äußere Schicht; weiter innen liegt die Liebe …
Noch tiefer im Inneren gibt es Gebete …
Und immer tiefer im Inneren liegt das Göttliche.
Sex kann zu einer kosmischen Erfahrung werden.
Deshalb nennen wir es Tantra.“
— Jolan Chang, Das Tao der Kunst des Liebens
C. Die schwimmende Welt
Ukiyo (Japan), Fusheng (China): Die Schönheit der Vergänglichkeit
Ästhetische Antwort auf Leid und Leere.
In Fengliu ist die Welt keine Illusion, vor der man fliehen muss – sie ist ein Traum, den man durchqueren muss. Ein zerbrechlicher, veränderlicher, flüchtiger Traum.
Weit davon entfernt, sich durch Ablehnung davon lösen zu wollen, beschließt der Mann des Windes, als Dichter dorthin zu wandeln: Er feiert die Vergänglichkeit, anstatt sie zu verfluchen. Er macht die Vergänglichkeit der Dinge nicht zu einem Schmerz, sondern zu einer Schönheit.
In China sprechen wir von fúshēng (浮生) – dem „schwebenden Leben“: dieser leichten und unsicheren Existenz, ähnlich einer Blase auf dem Wasser. Ein Bild, das aus dem Zhuangzi entlehnt ist, wo das menschliche Leben mit einem haltlosen Traum, einem flüchtigen Tanz verglichen wird.
In Japan wurde dieses Konzept zu Ukiyo (浮世) – der „fließenden Welt“ –, was sowohl die Vergänglichkeit des Lebens als auch die kultivierte Kultur bezeichnet, die es mit Anmut akzeptiert.
Ukiyo-e-Drucke, Haikus, Szenen der Freude und Melancholie sind die bekanntesten Erscheinungsformen. Wir sehen vergängliche Kurtisanen, fallende Blumen, im Mondlicht getauchte Gesichter – als wollten sie sagen: „Da alles vergeht, lasst uns alles im Vorübergehen schön machen.“
In dieser Vision ist Schönheit nie perfekt: Sie ist vergänglich.
Es erscheint, zittert und verschwindet dann – wie ein Blatt im Wind, ein lautes Lachen im Regen, ein Kuss im Schatten.
Die Welt lässt sich nicht korrigieren und man muss auch nicht vor ihr fliehen: Man muss sie in ihrem ganzen Zittern lieben.
Die schwebende Welt ist auch eine Reaktion auf die Leere.
Anstatt die Abwesenheit zu füllen, bewohnen wir sie. Anstatt die Vergänglichkeit zu leugnen, feiern wir sie.
Es ist eine Ästhetik des Fragilen, eine Spiritualität der sanften Auflösung.
Wer nach dem Geist des Fusheng lebt, erwartet keine dauerhaften Grundlagen.
Er baut Nebelgärten, schreibt Verse auf Fächern, beobachtet das Fallen der Blätter, ohne sie aufhalten zu wollen.
Er weiß, dass Schönheit gerade deshalb entsteht, weil sie vergeht.
Er hofft nicht auf die Ewigkeit – er sucht die pure Brillanz des Augenblicks.
In der schwimmenden Welt ist alles ein Angebot:
Eine Blume, die auf eine Tasse Tee gefallen ist.
Das Rascheln eines vom Wind angehobenen Vorhangs.
Die Stille, die auf ein Gedicht folgt.
Und so macht der Fengliu-Taoismus zwischen Lachen, Rückzug und der Zärtlichkeit des Blicks die Vergänglichkeit zu einer leichten Wohnstätte, in der selbst die Leere den Geschmack von geteiltem Tee hat.

「泉涸,魚相與處於陸,相呴以濕。」
„Wenn die Quelle trocken ist, stapeln sich die Fische auf dem Boden und befeuchten sich gegenseitig mit ihrem Atem oder ihrem Schaum. Es wäre besser, sich in den Seen und Flüssen zu vergessen.“
Zhuangzi
V – Ein zeitgenössischer Weg? Fengliu heute
A. Drei moderne Figuren
Chögyam Trungpa, Taisen Deshimaru: exzentrisches Erwachen, paradoxe Inkarnation
Der Mahasiddha: Der heilige Verrückte
Fengliu ist keine eingefrorene Erinnerung an das alte China. Es ist ein Geist – ein Wind –, der die Zeiten überdauert und neue Formen annimmt, wenn die Zeit es erfordert. In der heutigen Zeit findet er überraschende Widerhall in Figuren, die, ohne explizit zu seinen eigenen zu gehören, dennoch sein Wesen verkörpern: innere Freiheit, Ablehnung starrer Normen, Verbindung von Heiligem und Profanem und die Fähigkeit, Konventionen aufzubrechen, um das Wesentliche besser freizulegen.
Chögyam Trungpa – Der Meister ohne Krawatte
Chögyam Trungpa wurde in Tibet geboren und schon in jungen Jahren als Tulku anerkannt und in der Strenge des tibetischen Buddhismus ausgebildet. Doch nach seinem Exil entfernte er sich von den institutionellen Formen der Tradition und schlug einen einzigartigen, subversiven und schillernden Weg ein. Im Westen lehrte er den Dharma im Anzug, rauchte, trank und verführte – blieb aber unglaublich klar, wenn er von Leere, Präsenz und der Fußball-Weltmeisterschaft sprach.
Trungpa verkörpert eine radikale innere Freiheit. Er schockiert, verstört, trifft aber ins Schwarze. Er schafft neue Formen, wie das Konzept des „spirituellen Kriegers“, gründete die Naropa-Universität und initiierte eine Ästhetik des Heiligen im Alltag (enge Laken, anmutig servierter Tee, direkter Blick).
Wie die Weisen des Bambuswaldes oder die Dichter-Einsiedler trennt er nie Inhalt von Form: Er lehrt durch seine Art zu sein, manchmal provokativ, immer brennend. Er verkörpert ein Fengliu des 20. Jahrhunderts – einen Hauch aus der Leere, der durch den Kelch Wein gelangte und durch das Zerreißen der Mönchsgewänder in den Westen gelangte.
Taisen Deshimaru – Der Sandalenmönch
Taisen Deshimaru, ein japanischer Zen-Mönch, der Ende der 1960er Jahre ohne offizielle Unterstützung nach Frankreich geschickt wurde, kommt in Paris an und hat nur seine Praxis und eine kompromisslose Einfachheit im Gepäck. Er hat keinen Tempel, keine Schüler, keinen Plan – aber er kennt Zazen: regungslos dasitzend, nackt, scharf wie ein lautloser Säbel.
Deshimaru verkörpert eine raue und direkte Form der Spiritualität: ungeschönt, kompromisslos. Er spricht von Haltung, von Atmung, vom Leben als einem Sprung ins Leere in jedem Moment. Er lacht, raucht, flucht manchmal, aber er kehrt immer zur leeren Tasse des gegenwärtigen Augenblicks zurück.
Mit seinem unkonventionellen Stil, mit seiner Art, Regeln zu unterlaufen, ohne sie zu verraten, erinnert er an wandernde Ryōkan oder an die bergverrückten Chan. Er will nicht gefallen – er will erwecken. Und oft nimmt dieses Erwachen die Form eines sanften Schlags an, von Schlamm, der in Stille zerplatzt.
Er pflanzte Zen in französischen Beton wie eine Kiefer in eine Industriebrache – und beobachtete das Wachstum der Knospen, ohne sie jemals zu zwingen.
Der Mahasiddha: Zwischen Feuer und Wahnsinn
In den tantrischen Traditionen Indiens und Tibets sind Mahasiddhas die verwirklichten Meister seltsamer Formen: Friedhofsyogis, lachende Bettler, liebevolle Asketen, stille Propheten. Sie trotzen Erwartungen, zerstören Idole, leben am Rande der Gesellschaft und machen ihr eigenes Leben zu einem Gong-an ohne Lösung.
Es sind aufgeklärte Menschen, die nicht mit Worten lehren, sondern mit Gesten, Abwesenheiten und Geistesblitzen.
Wir finden sie in Mythen, in Legenden – aber vielleicht auch in diesen modernen Meistern, die in zerknitterten Anzügen herumlaufen, die beim Unterrichten eine Zigarette rauchen, die den Mond betrachten, ohne zu versuchen, ihn zu verstehen.
Fengliu ist in ihrem Gefolge keine alte Erinnerung mehr – es wird zu einer gegenwärtigen Möglichkeit.
Ein Stil des Erwachens.
Eine freudige Ablehnung spiritueller Schubladen.
Ein inneres Feuer, sanft, unbändig.

Nicht projizieren, nicht denken, nicht analysieren
Kultiviere nicht, handle nicht, habe weder Erwartung noch Angst
Und die mentalen Muster, die ihm Realität zuschreiben, werden von selbst verschwinden.
Dann stoßen Sie auf die Natur der Phänomene .
Tilopa-
Dohākoṣa von Tilopa – Vers 9
B. Mein persönlicher Weg
Der wandernde Gemmologe: Schönheit, Einsamkeit, Schöpfung, Präsenz
Ich bin weder Mönch noch Meister. Ich habe nie eine Schule gegründet und auch nicht behauptet, zu lehren. Aber ich bin gelaufen. Langsam. Weit entfernt von geraden Wegen.
Zwischen den Bergen Tibets und den mineralogischen Salons Europas, zwischen einer Halskette aus geschliffenem Türkis und der unberechenbaren Krümmung einer Amethystgeode folgte ich dem, was manche Zufall, andere Schicksal nennen – und was ich einfach den Wind nenne.
Ich schlief in verlassenen Tempeln, unter den Zelten Asiens und in Bahnhöfen, wo man noch immer die alten Stimmen der Reisenden hören kann. Ich bearbeitete Steine mit meinen Händen, schnitzte Malas mit meinem Herzen und verkaufte meine Kreationen, ohne ihnen jemals einen Preis zu nennen – denn sie trugen ein Stück der Reise in sich.
Gemmologe, ja. Aber kein Labor. Ich suche das Licht im Stein, die Seele im Material, die Stille im Kristall. Jeder Einschluss, jeder Bruch, jeder Regenbogenreflex ist eine Lektion für mich. Ich sammle nicht: Ich betrachte. Ich verkaufe nicht: Ich gebe weiter. Oder besser gesagt: Ich lasse die Dinge zirkulieren.
Ich begegnete Fengliu im Blick eines alten chinesischen Handwerkers, im Atem eines Sees in Yunnan, in der Holzmaserung eines tragbaren Altars, in einer Tasse Tee, die ich mit einem Fremden teilte. Ich habe es nicht gelernt – es streifte mich. Wie der Wind, der einen Felsen berührt, ohne ihn zu zerbrechen.
Für mich geht es beim Schaffen nicht ums Verzieren. Es geht ums Zuhören. Zuhören, was das Material verlangt, was der Moment erlaubt. Jedes Schmuckstück, jedes Objekt, das ich erschaffe, ist eine Spur, ein gefrorener Atemzug, der zu einem Opfer geworden ist. Und ich weiß nie, ob es wirklich mir gehört. Ich bin eher ein Fährmann als ein Bildhauer.
Die Einsamkeit belastet mich nicht. Sie ist meine nomadische Einsiedelei. Ich spreche wenig, aber ich beobachte. Ich verbringe Stunden vor einer Wolke, die an einem Bergrücken hängt, vor einem Obsidian, der seine Spiegelbilder bis zum richtigen Lichteinfall geheim hält. Es ist keine Geduld – es ist Präsenz.
Ich lebe zwischen zwei Welten: der des sichtbaren Handels und der der inneren Stille. Ich gehöre weder zum Laden noch zum Kloster. Ich verkaufe, ja, aber ich gebe auch. Ich gehe durch die Welt, aber ich lasse mich nirgendwo nieder.
Ich habe keine feste Adresse – irgendwo warten Steine auf mich und Leute, die ich unterwegs treffe. Das reicht.
Fengliu ist für mich kein altes Konzept: Es ist ein Hauch, der mich noch immer leitet. Er sagt mir, dass ich nichts erzwingen soll. Eleganz der Macht vorziehen. Aufrichtigkeit der Demonstration. Schweigen der Rede.
Vielleicht bin ich ein Einsiedler ohne Höhle. Ein Mönch ohne Tempel. Ein Dichter ohne Buch.
Aber ich weiß, wie man Schönheit erkennt, wenn sie entsteht. Und ich verneige mich.

Machen Sie Schluss mit spirituellen Geboten.
Trau dich, Poesie, Wind, innere Stille.
In einer Welt voller Aufforderungen zum „Erwachen“, zur „Verwandlung“, zur „höheren Schwingung“ bietet Fengliu nichts. Es lädt uns einfach zum Atmen ein. Es verspricht keinen Frieden – es passt sich dem Tumult an, ohne sich zusammenzuziehen. Es zeichnet keinen Weg vor – es folgt den Strömungen, den Umwegen, dem Nebel.
Es gibt nichts zu erreichen. Nichts zu verbessern. Nichts zu bereinigen.
Freie Eleganz beginnt hier: wenn wir aufhören, uns zum Werden zu zwingen, und endlich das bewohnen, was ist. Nicht als Opfer, nicht als Krieger, sondern als Dichter. Sie wird nicht an Disziplin oder Fortschritt gemessen, sondern an der Qualität der Aufmerksamkeit: am Licht auf einer Schüssel, an der Müdigkeit des Abends, am Schatten des Windes an der Wand.
Es ist Spiritualität ohne Performance, Weisheit ohne Spektakel.
Mantras oder Kurse sind nicht erforderlich.
Sie müssen sich nicht selbst reparieren: Hören Sie einfach zu.
Und in dieser klaren Hingabe öffnet sich etwas.
Kein Blitz, sondern ein sanftes Schaudern:
der Geschmack von Tee, Staub in einem Lichtstrahl, die Langsamkeit einer Hand.
Fengliu ist heute kein Relikt, sondern eine subtile Notwendigkeit.
In einer Welt, die damit beschäftigt ist, zu „heilen“, bietet es die Heilung des Nicht-mehr-Heilungswillens.
In einer Welt, die von Zielen besessen ist, bietet es eine Bank unter einem Baum.
Poesie ist hier kein Luxus, sondern ein Heilmittel.
Schweigen ist keine Leere, sondern Zuflucht.
Und der Wind? Der Wind ist der Herr.
Wer es wagt, nichts zu suchen, entdeckt eine verlorene Kunst:
das Leben ohne Anhaften, das Lieben ohne Greifen, das Gehen ohne Karte.
Es ist keine Flucht, es ist eine Rückkehr.
Eine Rückkehr zu geschmeidiger Eleganz, zu diskreter Schönheit, zu lebendigem Nichts.
Fengliu drängt sich nicht auf. Es bietet sich an – wie eine Brise, wie ein Lachen, wie eine Haarlocke über den Augen.
Wer sich darauf einlässt, braucht weder Glauben noch Anstrengung mehr:
er wird die einfache Würde des Daseins wiedererlangt haben,
an seinem Platz, in der Stille der Welt.

In diesem Wissen um das Unmittelbare stört nichts. Alles fällt zusammen, alles ist im Einklang mit dem Gewöhnlichen. Es ist, als ob man sein Haus verlässt und Wolken am Himmel schweben sieht. Dann wissen wir, dass alle etablierte Philosophie lächerlich ist. Wir nehmen unseren Stab und gehen friedlich die Wege der Welt entlang.
Antoine Marcel – Mein Leben in den Bergen
FAZIT – Mit dem Wind gehen
Fengliu als die Kunst, in Schönheit zu verschwinden
In einer Zeit, in der alles uns dazu drängt, uns zu zeigen, uns zu definieren, uns zu erheben, bietet Fengliu ein Verschwinden an. Kein Entkommen, sondern eine sanfte Auslöschung, eine Möglichkeit, die Welt zu bewohnen, ohne sie mit seinen Spuren auszulöschen.
In einem Zeitalter voller Rezepte, Aufführungen und spiritueller Versprechen bietet er Weisheit ohne Ziel, einen Weg ohne Karte, Frieden ohne Spektakel.
Er schreit nichts. Er erwartet nichts.
Es weht einfach wie eine Brise über die Oberfläche einer Teeschale.
Fengliu zu sein bedeutet nicht, weise zu werden –
Es ist mutig, nicht zu verhärten.
Bleiben Sie nicht in einer Haltung, einer Rolle, einer Wahrheit stecken.
Es ist ein Gehen ohne Ziel,
erstellen ohne zu unterschreiben,
zu lieben, ohne behalten zu wollen.
Es ist, als würde man der Leere einen Kelch anbieten,
und lächeln, wenn es aus der Stille herausströmt.
Dies ist kein Weg zur Erfüllung –
sondern bis zur Auslöschung aufzuhellen.
Wo es nichts mehr zu beweisen gibt,
vielleicht gibt es endlich etwas, das man lieben kann.
Und wenn du jemals nach mir suchst,
Suche nicht nach Spuren.
Ich werde im Glanz einer vergessenen Jade sein,
oder im Schweigen einer Hand, die nichts erwartet.
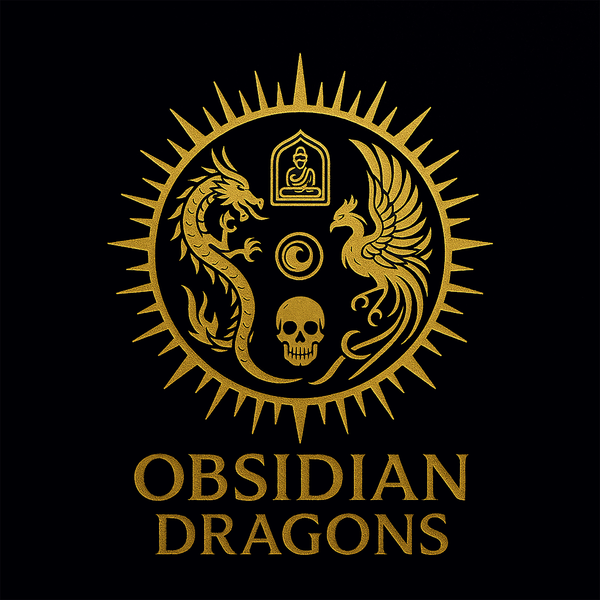
3 Kommentare
Merci jeremy,
Merci pour ce souffle partagé,
Merci.
Voglio pensare di essere anch’io…. fengliu
Grazie per il tuo scritto
La mia vita ha più valore
Merci Jeremy. Nos nombreux échanges nous amènent souvent à cette évidence, il est bon de vivre les phénomènes de cette existence sur le souffle du vent.
Il est toujours bon de te lire.